
Kita-Eingewöhnung: für viele Eltern ein sehr emotionales Thema. Wir haben uns gefragt: Wie klappt eine Eingewöhnung eigentlich bedürfnisorientiert? Was können wir tun, wenn wir mit den Erzieher*innen inhaltlich und emotional so gar nicht auf einer Wellenlänge sind? Und woran merken wir, ob es unserem Kind wirklich gut geht? Antworten gibt in diesem Artikel Psychologin und Influencerin Isabel Huttarsch. Ehrliche Einblicke ins Elternleben bekommen Sie dazu von Kerstin Lüking und Dorothee Dahinden.
Die Kindergartenzeit meiner Kinder hat uns als Familie irgendwie geprägt. Noch heute fallen uns die tollsten Geschichten ein, wenn wir an unserer ehemaligen Kita vorbeifahren. Insgesamt waren es fast 20 Jahre, an denen ich, Kerstin, dort tagein tagaus immer eins unserer Kinder abgegeben habe. Denn bei sieben Kindern mit einer Altersspanne von 17 Jahren, kommt da einiges an Zeit zusammen, in der wir an diese Institution gebunden waren. Ich erinnere mich an unendlich viele Faschingskostüme, Weihnachtsfeiern und Abschiedsfeste. An Unmengen von Luftballons, Muffins und Kinderlieder.
Endlich Kita – endlich Freiheit?!
Ich erinnere mich aber auch an die ersten Tage in der Kita. Es war so ein Gefühl von zurückgegebener Freiheit. Das hört sich jetzt vielleicht etwas schräg an, aber wenn ich mal so ganz tief in mich gehe, kann ich es nicht anders formulieren: Ja, es war tatsächlich das erste Loslassen vom Kind und wieder ein Schritt in mein altes Leben. Die erste Zeit nach der Geburt, die ersten Monate danach – es ist eine kleine Symbiose der Glückseligkeit, aber auch der totalen Aufgabe der eigenen Person, da sich vieles im Alltag „nur noch“ ums Kind dreht.
Wenn dann der Schritt gewagt wird, den eigenen Nachwuchs fremd betreuen zu lassen, ist das schon ein neuer, einschneidender Lebensabschnitt. Für uns Eltern und natürlich auch für unser Kind. Wir stellen fest, dass unsere Kinder plötzlich „groß“ geworden sind, sich schnell verändern und jeder Tag etwas Neues an Entwicklungsschritten mit sich bringt. Eigentlich doch großartig und für mich wäre eine Kita auch nie wegzudenken gewesen. Ohne diese vielen tollen Erzieher*innen hätte ich nicht meinen Beruf ausüben können.
Eingewöhnung: Ich hatte Druck
Wie war es nun in den ersten Tagen in der Kita? Wir waren immer schnell mit der Eingewöhnung. Ich hatte Druck, es musste laufen, da die ersten Wöchnerinnen, die ich zu betreuen hatte, schon in der Warteschleife hingen. War ich vielleicht zu „streng“ mit mir und meinen Kindern? Oder hatte ich einfach nur Glück? Vielleicht!
Wir hatten tolle Jahre, viele Freundschaften haben sich ergeben. Freundschaften, die tatsächlich heute noch Bestand haben.
Aber dennoch: Als ich am allerletzten Kita-Tag mit meiner jüngsten Tochter durch die Tür ging, habe ich aufgeatmet. 20 Jahre Laterne basteln … es war vorbei!

Isabell Huttarsch, Psychologin (© Dorothee Dahinden)
ab 33,95 €
ab 32,95 €
ab 23,95 €
ab 25,95 €
45,40 €
ab 25,95 €
79,00 €
ab 45,00 €
ab 47,00 €
ab 45,00 €
ab 45,00 €
ab 45,00 €
ab 47,00 €
ab 47,00 €
ab 42,00 €
ab 45,00 €
ab 64,95 €
ab 47,00 €
39,95 €
39,95 €
39,95 €
ab 33,95 €
ab 33,95 €
ab 30,95 €
ab 30,95 €
ab 33,95 €
ab 33,95 €
ab 32,95 €
ab 30,95 €
ab 33,95 €
Wie klappt eine sanfte Eingewöhnung?
Wie kann es denn nun gut klappen mit der Eingewöhnung und am besten auch noch bedürfnisorientiert? Wir haben uns die Psychologin Isabel Huttarsch von mamapsychologie.de ins Boot geholt und mit Fragen gelöchert:
Liebe Isabel, ich, Kerstin, habe es oft erlebt, dass Eltern sich ewig lange in der Garderobe in der Kita aufgehalten haben. Auf dem Schoß das an sich klammernde Kind und das Elternteil voll mit Worten des Tröstens und Beschwichtigens. In solchen Momenten ging mir immer durch den Kopf: „Mensch, jetzt geh doch endlich und hör auf zu reden. Du machst das alles nur noch schlimmer fürs Kind“. Sei ganz ehrlich: Bin ich da eine Rabenmutter, wenn ich so etwas gedacht habe?
Liebe Kerstin, diese Gedanken machen dich selbstverständlich nicht zu einer Rabenmutter. Sie sind vollkommen menschlich. Das unangenehme Gefühl, das dich beim Beobachten solcher Situationen beschleicht, ist eigentlich sogar sehr sinnvoll. Denn es möchte eigentlich nur eines: Dich darauf aufmerksam machen, dass diese Situation belastend ist und dich dazu motivieren, etwas zu tun, damit das aufhört. So funktionieren wir evolutionsbedingt.
Eine sichere Bindung zu einem*r Bezugserzieher*in ist das Fundament!
Allerdings ist dieser Handlungsimpuls in der Garderobensituation nur bedingt hilfreich. Denn du hast nur einen beschränkten Einblick in das, was da gerade passiert. Denn ob das Kind „trennungsbereit“ ist oder nicht, und die Eltern dementsprechend gehen oder doch bleiben sollten, hängt von mehreren Faktoren ab. Es gibt kein pauschal „richtiges“ Verhalten. Wichtig ist, dass sich die Tatsache, ob ein Kind trennungsbereit ist oder nicht, nicht erst in der Garderobe entscheidet. Denn was das Kind braucht, um loslassen zu können, ist eine sichere Bindungsbeziehung zu einem*r Bezugserzieher*in. Und Tränen sind nicht gleich Tränen. Ist ein Kind sicher an mindestens ein*e Erzieher*in gebunden, dann kann und sollte sie diese die Trauer und die Wut des Kindes auffangen und begleiten. Fehlt diese sichere Bindung hingegen, dann kann die Trennung vom Elternteil tatsächlich Schaden in der Psyche des Kindes anrichten.
„Wo immer möglich, Druck rausnehmen!“
Wie könnte denn eine gute Kita-Eingewöhnung aussehen? Ich denke da vor allem sehr oft an die Mutter: Wir sind gestresst, haben Termindruck, sind darauf angewiesen, dass alles zeitgerecht eingetaktet wird, damit wir am Tag X wieder zur Arbeit gehen können und uns unsere Kinder möglichst nicht tränenreich hinterherschauen.
Da lohnt es sich, zunächst einmal zu hinterfragen, was „gut“ in diesem Kontext überhaupt bedeutet. Eine Eingewöhnung ist dann gut, wenn sie dem Kind und den Eltern ermöglicht, während des Eingewöhnungsprozesses sicher in der neuen Situation anzukommen und beide vom Personal und den Rahmenbedingungen dabei bestmöglich unterstützt werden. Wie lange dieser Prozess dauert, ist individuell sehr unterschiedlich. Wie viel Unterstützung und Begleitung ein Kind braucht, lässt sich nicht pauschalisieren.
34,99 €
Statt 34,99 €
31,99 €
29,95 €
22,95 €
Statt 28,99 €
20,99 €
Statt 54,00 €
43,99 €
23,99 €
23,99 €
39,99 €
39,99 €

Das Credo eine erfolgreichen Eingewöhnung: Alles, was dem Kind und den Eltern Vertrauen sowie Sicherheit gibt, unterstützt den Prozess. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wo immer möglich, Druck rausnehmen! Druck wirkt als Gegenspieler und verzögert bzw. verhindert den Aufbau von Vertrauen und Sicherheit. Um den Zeitdruck zu reduzieren, könntest du mit deinem Kind beispielsweise schon vor der eigentlichen Eingewöhnung wöchentlich zu einer Spielstunde am Nachmittag in der Kita vorbei kommen. Dann kann sich das Kind schon einmal ganz in Ruhe und ohne Trennungsgedanken mit den Rahmenbedingungen und Abläufen vertraut machen.
Es lohnt sich, wenn Sie zeitlichen Puffer einplanen!
Außerdem lohnt es sich, bei der zeitlichen Planung der Eingewöhnung lieber ein paar Wochen Puffer zu viel einzukalkulieren als zu wenig. Optimal ist es natürlich, wenn es zudem einen Plan B gibt für das „Worst Case-Szenario“. Also was ist, wenn die Eingewöhnung tatsächlich länger dauert? Können Partner*in oder Großeltern dann vielleicht übernehmen? Wenn möglich, dann sollte der Zeitpunkt der Kita-Eingewöhnung so gewählt werden, dass „drumherum“ möglichst wenig los ist, also keine Urlaube, keine Umzüge und andere „Events“, die dir und deinem Kind zusätzliche Ressourcen kosten.
Im Eingewöhnungsprozess steht und fällt alles mit der sicheren Bindungsbeziehung deines Kindes zum*r Bezugserzieher*in. Der Aufbau einer solchen Bindung benötigt Zeit und gemeinsame Interaktion. Wir als Eltern sind dabei die Brücke. Das bedeutet, dass unsere Kinder über die Beziehung, die wir mit der Einrichtung und dem Personal haben, ihre eigene Bindungsbeziehung entwickeln. Deswegen ist es zentral, dass wir als Eltern die Eingewöhnung auch für uns nutzen, um ins Vertrauen zu kommen. Die Eingewöhnung ist auch für uns Eltern da. Lerne Einrichtung und Personal kennen, frage bei Unklarheiten nach. Damit schaffst du die beste Basis für dein Kind, um neue Bindungsbande zu knüpfen.

Zeitbasierte Eingewöhnungsmodelle sollten flexible Anhaltspunkte bieten.
Zeitbasierte Eingewöhnungsmodelle, wie das Münchner oder das Berliner Modell, sollten keine starren Vorgaben sein, sondern lediglich flexible Anhaltspunkte bieten. Der zeitliche Ablauf der Eingewöhnung und die Frage, wann die erste Trennung stattfindet, sollte sich immer an der Bindungsbeziehung zwischen dem Kind und dem*r Bezugserzieher*in orientieren.
Wozu rätst du, wenn ein Elternteil merkt, dass es einfach nicht geht. Dass mein Kind sich irgendwie nicht wohl fühlt und ich eigentlich auch kein gutes Gefühl mit den Betreuungspersonen habe? Gibt es spezielle Indikatoren, an denen wir festmachen können, dass etwas völlig schiefläuft?
Der beste Indikator ist der ehrliche Blick auf dein Kind und auf dich selbst. Wenn wir ein solches Gefühl haben, dass etwas nicht gut läuft oder unpassend ist in der Eingewöhnung, tendieren wir dazu es von uns wegzuschieben, wollen das nicht wahrhaben. Schließlich haben wir lange auf den Kita-Platz gewartet und haben unter Umständen keine Alternative vor Augen. Wir glauben, es „muss“ funktionieren. Für alle Beteiligten ist es das Beste (und auch das zeiteffizienteste), Probleme und Herausforderungen frühzeitig als solche zu erkennen, zuzulassen und anzusprechen.
Feinfühligkeit für das Kind und die Situation ist einer der wichtigsten Schlüssel!
Für fast alles gibt es eine Lösung, auch, wenn diese manchmal maximales Umdenken und in seltenen Fällen auch einen Abbruch der Eingewöhnung erfordert. Ein weiterer wichtiger Indikator dafür, ob die Betreuungspersonen ihren Job gut machen und dein Kind dort gut aufgehoben ist, ist Feinfühligkeit. Feinfühligkeit beschreibt, inwiefern die Erzieher*innen Bedürfnisse deines Kindes erkennen und angemessen darauf reagieren. Feinfühliges Verhalten ist die grundlegende Basis dafür, dass eine Bindungsbeziehung überhaupt entstehen kann. Geben dies das Kita-Konzept oder die alltäglichen Rahmenbedingungen nicht her, dann kann das Kind nicht gut ankommen.
Du merkst, wenn es deinem Kind nicht gut geht. In diesem Fall ist Detektivarbeit angesagt: Was fehlt deinem Kind, um sicher anzukommen?
Manchmal ist der einzige Ausweg tatsächlich der Abbruch einer Eingewöhnung. Dieser Schritt fühlt sich oftmals wie ein Fall ins Bodenlose sein, kann aber in bestimmten Konstellationen die für den Moment richtige Entscheidung sein.
Manche Mütter haben mir vorgeworfen, dass ich meine Kinder sehr früh in die Kita gebracht habe. Der Standardspruch war: „Dafür bekommt man doch keine Kinder, damit man sie in einer Institution abgibt.“ Sie würden ihre eigenen Kinder erst mit drei Jahren in die Kita geben. Also, ganz ehrlich: Es gibt Mütter und Familien, die sich das einfach nicht leisten können. Abgesehen davon lernt ein Kind unter gleichaltrigen Spielkameraden extrem schnell. Kannst du da ein wenig Last von den Schultern der Eltern nehmen, die sich für einen frühen Kita-Besuch entschieden haben?
Ob ein Kind in der Kita gut aufgehoben ist, hängt nicht primär vom Alter des Kindes ab. Um diese Frage zu beantworten, müssen vielfältige Faktoren berücksichtigt werden. Was jedoch klar ist: Kein Kind hat etwas davon, wenn seine Eltern (unabhängig davon, ob erwerbs-arbeiten oder care-arbeiten oder beides) wegen diverser Vorurteile auf die Betreuungsunterstützung der Kita verzichten und in der Konsequenz dann ausbrennen. Die Kita kann und darf eine wertvolle Ressource im Familienleben sein.

„Entscheidungskriterium sollten immer die Bedürfnisse aller Beteiligten sein.“
Gleichzeitig gibt es Studien, die zeigen, dass gerade für jüngere Kinder im Durchschnitt die folgende Faustregel Sinn macht: je jünger, desto weniger Stunden Fremdbetreuung am Stück. Aber auch hier macht es keinen Sinn, pauschale Aussagen zu treffen. Entscheidungskriterium sollten immer die Bedürfnisse aller Beteiligten sein, also des Kindes und der Eltern. Denn diese hängen, wie bei einem Mobile, alle zusammen. Geht es dem einen Teil nicht gut, hat das Auswirkungen auf alle anderen.
Dein Thema ist ja die bedürfnisorientierte Eingewöhnung: Was heißt das genau? Und wie setzen wir sie um?
Bedürfnisorientierte Eingewöhnung bedeutet nichts anderes, als dass sich die Eingewöhnung an Bedürfnissen orientiert – und zwar an denen des Kindes und denen der Eltern. Das bietet Kindern und Eltern im Eingewöhnungsprozess die bestmöglichen Voraussetzungen, um gut, sicher und schnell in diesem neuen Lebensabschnitt anzukommen. Gleichzeitig bedeutet Bedürfnisorientierung auch, dass es kein starres Konzept geben kann, an dem man sich blind entlang hangelt.
Wir sollten immer die Bedürfnisse des Kindes im Blick haben.
Eine bedürfnisorientierte Eingewöhnung erfordert somit von allen die Bereitschaft, genau hinzuschauen und genau hinzuhören – beim Kind und bei sich selbst. Hilfreiche Leitfragen sind: Was brauche ich, was brauchst du und was brauchen wir, damit du gut in der Kita ankommen kannst? Niemand kann vorhersehen, wie lange ein Kind benötigt, um sicher anzukommen und eine tragfähige Bindungsbeziehung zum*r Bezugserzieher*in aufzubauen. Je mehr wir in diesem Prozess jedoch die Bedürfnisse des Kindes im Blick haben, desto reibungsloser und nachhaltiger wird der Prozess ablaufen, auch, wenn es sich zu Beginn vielleicht anders anfühlen mag.
Das psychische Bedürfnis, das für die Eingewöhnung die zentrale Rolle spielt, ist das nach Bindung und Sicherheit. Alles, was unser Kind und uns selbst dabei unterstützt, sich sicher zu fühlen in der neuen Umgebung und mit den neuen Menschen, hilft dabei, gut im Kita-Alltag anzukommen. Wichtig ist: Wir sind dabei die Referenzperson für unsere Kinder. Unsere Kinder merken uns an, wenn wir uns unwohl fühlen oder zweifeln. Deswegen ist es so wichtig, Zweifel und Unklarheiten frühzeitig mit der Einrichtung zu besprechen und anzugehen.
Klare Kommunikation ist schon beim Kennenlerngespräch hilfreich!
Wie gehen wir damit um, wenn Erzieher*innen die „alte Schule“ praktizieren, wir aber bedürfnisorientiert handeln möchten?
Vermutlich meinst du mit „alte Schule“, dass sich die „Erzieher*innen“ an einem starren Konzept orientieren oder gar ganz ohne Konzept in der Eingewöhnung eine zu frühe Trennung von Eltern und Kind einfordern. Dieses Vorgehen kann deinem Kind und auch eurer Bindungsbeziehung im schlimmsten Fall tatsächlich schaden. Gleichzeitig verhindert es, dass dein Kind eine sichere Bindungsbeziehung zu den Erzieher*innen aufbaut. Druck auf das Kind und auf die Eltern hilft hier tatsächlich nie weiter. Stattdessen ist es essenziell wichtig, frühzeitig mit der Einrichtung ins Gespräch zu gehen. Es ist hilfreich, bereits beim Kennenlerngespräch vor der Eingewöhnung die Karten auf den Tisch zu legen und klar zu kommunizieren, was euch als Eltern wichtig ist. Voraussetzung dafür ist natürlich eure eigene Klarheit darüber, was ihr für euer Kind möchtet, also was sind „must haves“, was „nice to haves“ und was absolute „no gos“ für euch? Und dann: So lange Fragen stellen, bis klar ist, ob die Einrichtung zu euch und ihr zur Einrichtung passt. Manchmal ist es allerdings auch so, dass sich zunächst alles rosig anhört und der Eingewöhnungs- und Kita-Alltag dann ganz anders aussieht. Auch hier ist die Basis eure eigene Klarheit: Fehlen hier lediglich „nice to haves“ oder geht das, was da abläuft, überhaupt nicht für euch? In beiden Fällen geht kein Weg an der Kommunikation mit der Einrichtung vorbei.
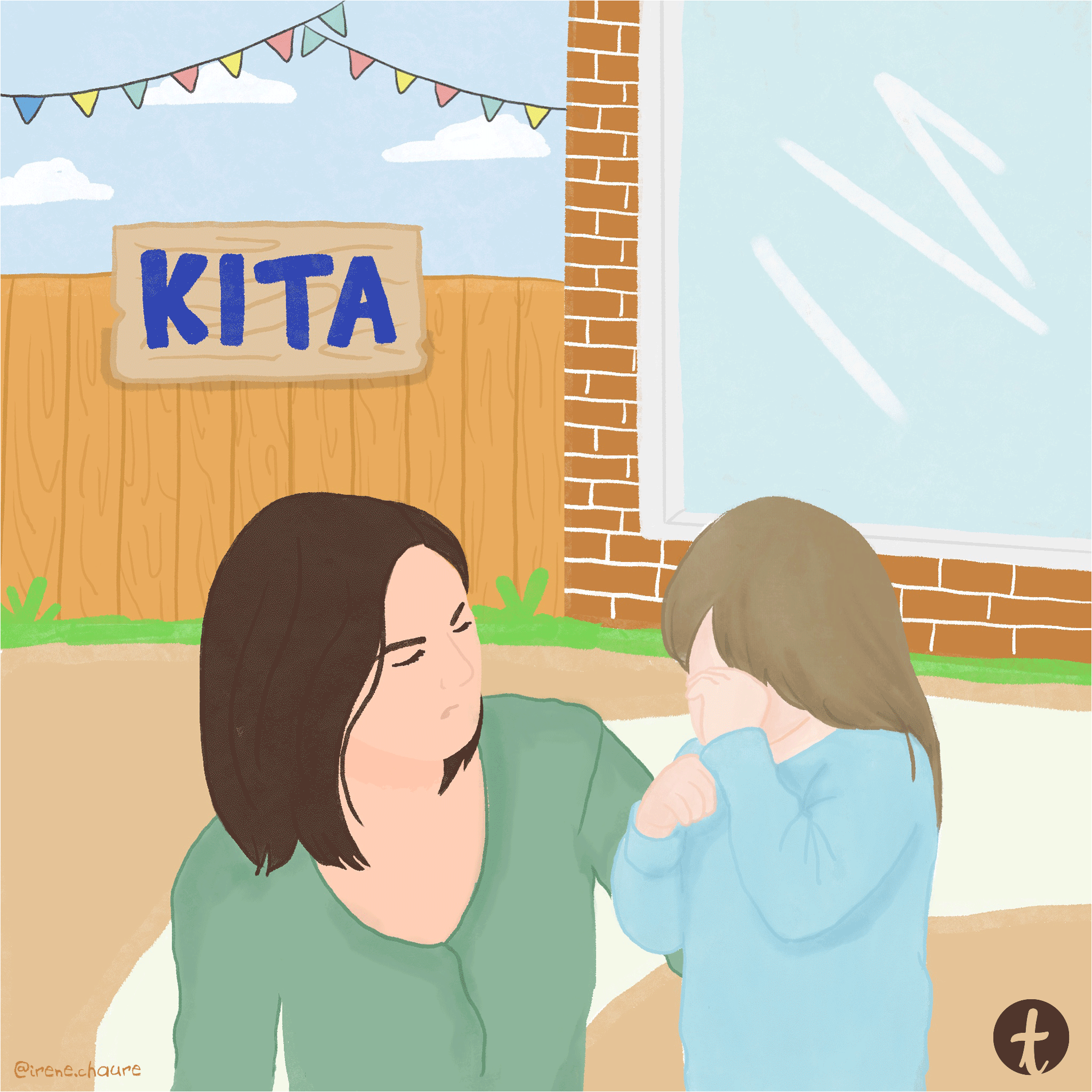
Es ist sinnvoll, wenn Sie aus der Ich-Perspektive kommunizieren!
Erzieher*innen empfinden solche Gespräche oftmals als Angriff. Deshalb ist es sinnvoll, aus der „Ich-Perspektive“ zu kommunizieren (z.B. „Ich habe an meinem Kind bemerkt, dass es noch etwas Zeit braucht, damit es vertrauensvoll loslassen kann“ statt „Sie fordern die Trennung viel zu schnell“). Viele Themen, die uns Bauchschmerzen bereiten, lassen sich in einem persönlichen Gespräch klären. Auch, wenn das von dir anfangs vielleicht etwas Mut erfordert. Doch das hast du mit deinem Kind im Eingewöhnungsprozess gemeinsam.
Mehr von Isabel Huttarsch
Lieben Dank für dieses wirklich hilfreiche Interview, liebe Isabel! Du hast eine unverwechselbare Sicht auf unsere Kinder und das Elternsein. Und wenn nun der Gedanke kommt: „Tolle Psychologin, wo finde ich mehr Tipps von ihr?“ Dann schauen Sie doch mal auf Isabels Instagramkanal vorbei. Extra für Mütter hat Isabel übrigens auch das Online-Dorf „Mindful Motherin“ gegründet, in dem Mamas viel Wissen und Tipps für den Alltag mit Kindern bekommen. Außerdem gibt Isabel auch einen Online-Kurs zum „bedürfnisorientierten Abstillen“, Online-Sprechstunden und Coachings – mehr dazu finden Sie auf Isabels Website. Übrigens ist Isabel auch Co-Autorin unseres ersten MutterKutter-Buches „Der Survival-Guide für Mamas“.

Dorothee Dahinden, Autorin, Mutter und Expertin von MutterKutter (© Anne Seliger)
Ich, Doro, lasse gerade Isabels Worte nachhallen und lächle. Denn sie findet Worte, die uns Eltern Stresssituationen erleichtern. Sie baut selbst bei der so oft heiß diskutierten Frage „Ab wann sollte ich mein Kind fremd betreuen lassen?“ keinen Druck auf. Im Gegenteil. Sie sieht alle Seiten und die Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Toll!
Bitte keine gegenseitigen Verurteilungen in Social Media!
Denn wissen Sie, was ich nicht mag, neee, mir richtig aufstößt? Dieses gegenseitige Verurteilen in Social Media, wenn es um genau dieses Thema geht. Wenn Kommentarspalten unter einem Zeitungsartikel oder einem Post heiß laufen, weil eine Familie erzählt, wieso sie ihr Kind mit einem Jahr in die Fremdbetreuung gegeben hat. Oder wenn eine andere Familie Einblicke in ihr kitafreies Familienleben gibt. Wie kann es sein, dass sich Eltern gegenseitig so verurteilen? Eltern, die sich nicht einmal persönlich kennen, sondern sich gerade online begegnet sind. Völlig absurd! Ich wünsche mir da viel mehr (virtuelles) Verständnis füreinander!
Danke an die Erzieher*innen!
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: die Kitas waren das Dorf, das wir vor Ort nicht haben. Meine Kinder haben dort nicht nur Liebe bekommen und viel gelernt, sondern auch Freund*innen fürs Leben gefunden. Natürlich ist da auch eine große Portion Glück dabei – denn viele Familien bekommen leider nicht die Einrichtung ihrer Wahl. Ich selbst bin immer gut damit gefahren, Dinge offen anzusprechen und ehrliches Feedback zu geben (das ich übrigens auch mir gegenüber erwarte). Ich bin bis heute irre dankbar für die tollen Erzieher*innen, die einen so wichtigen Job machen. Ein Job, der meiner Meinung nach viel besser bezahlt werden müsste und der in Corona-Zeiten sicherlich sehr kräftezehrend war!
Meine Tochter zog damals bei einer Einrichtung selbst den Schlussstrich!
Nicht immer passt die Einrichtung. Vor ein paar Jahren haben wir eine Betreuung tatsächlich von einem Tag auf den anderen abgebrochen. Unsere Tochter war damals zwei Jahre alt. Es gab ein paar Dinge, die uns aufgestoßen sind. Zum Beispiel, dass ich meiner Tochter keine frische Windel vor Ort machen durfte, obwohl das dringend nötig gewesen wäre. Stattdessen sollte ich nach Hause gehen. Oder dass sie fast jedes Mal schon vor der verabredeten Abholzeit wartend vor der Haustür saß. Ich war mir nie sicher, ob sich dort wirklich mit den Kindern beschäftigt wurde und wie oft die Kinder draußen waren. Stattdessen hörte ich eines mittags: „Wir waren heute nicht draußen, bei uns wurde Pflanzenschutzmittel gespritzt!“ Ich so: WHAT!? Mein Bauch grummelte schon von Anfang an. Das Grummeln wurde über die wenigen Wochen lauter. Denn insgesamt wirkte das eher wie eine Kinderverwahrung, als ein liebevolles Zuhause. Meine Tochter zog nach zwei Monaten selbst den Schlussstrich. Sie machte mir deutlich, dass sie da nie wieder hingehen würde. Wie? Indem sie auf meinen Satz, dass morgen wieder Betreuung sei, antwortete: „Dann habe ich morgen wieder Husten!“ Deutlicher ging es nicht. Nach zwei Monaten war Schluss. Und wir erleichtert. Dazu wurde mir Zeit mit meinen Kindern zuhause geschenkt – die Monate bis zur Eingewöhnung in die neue Kita konnten wir als Familie gut wuppen und genießen. Ich bin der Meinung: Wenn wir als Eltern genau hinschauen, die Signale unserer Kinder wahrnehmen, dann sind wir mit der Antwort auf die Frage „Welche Betreuung ist für mein Kind die richtige?“ schon einen großen Schritt weiter.
Statt 29,95 €
25,99 €
14,95 €
8,95 €
14,95 €
Statt 19,95 €
18,99 €
Statt 36,99 €
26,99 €
Statt 33,45 €
29,99 €
Statt 33,45 €
29,99 €
Statt 22,95 €
19,99 €
Schlagwörter






























































































